Sprechen ist Silber,
Singen ist Gold
15. September 2018
Am Ende fiel es mir wie Schuppen von den Augen: ich gehe zu deutsch an diese Sache heran. Mein germanischer Geist möchte die Laute sprechen. Aber die polnische Zunge mag keine Befehle; sie tanzt lieber mit den Lippen Tango. Polnisch muss gesungen werden. Nur so lassen sich die verschiedenen Nuancen der „ich“-, „schtsch“- und „chatsch“-Laute treffen. Deshalb haben wir uns damals im Russischunterricht immer so schwer getan. Apropos.
Slawisches Erbe
Kein Wunder, dass mir das so bekannt vorkam. Immerhin gehört Polnisch mit Russisch zur selben Sprachfamilie. Dabei unterscheidet man vereinfacht zwischen westslawischem Tschechisch, Slowakisch und Polnisch, ostslawischem Russisch, Ukrainisch und Weißrussisch, sowie südslawischem Bosnisch, Kroatisch und Serbisch. Der markanteste Unterschied ist, dass die Polen das lateinische Alphabet benutzen. Viele Vokabeln sind sich sehr änhlich, was den Einstieg in die Sprache für mich deutlich erleichterte. Hier ein paar Beispiele:
- Bruder: russ. брат (brat), poln. brat
- Fuß oder Bein: russ. нога (noga), poln. noga
- Milch: russ. молоко (moloko), poln. mleko
- Bier: russ. пиво (piwo), poln. piwo
- Nase: russ. нoc (nos), poln. nos
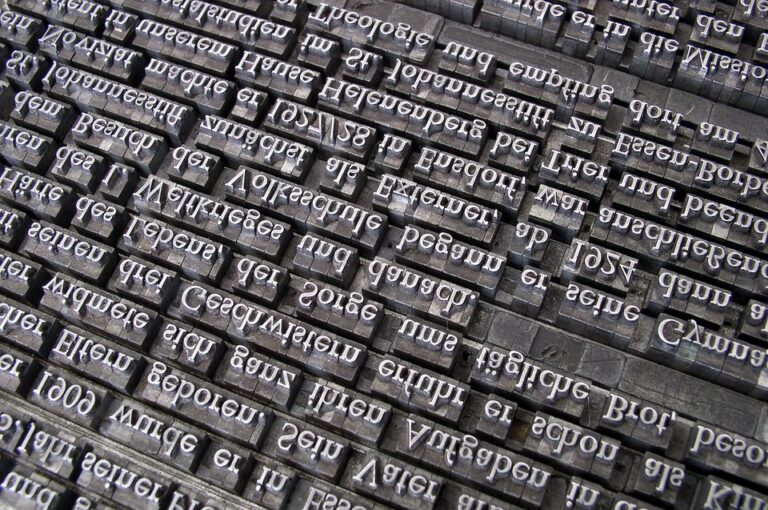
Dazu kommen noch ein paar eigene Zeichen. So stehen „ż“, „ś“, „ć“ für verschiedene „sch“-Laute, wobei diese auch mit „rz“, „sz“ und „cz“ gebildet werden können. Oder mit „zi“, „si“ und „ci“, wobei das „i“ am Ende ein bisschen mitschwingt. Ihr seht schon, Polnisch ist eine sehr feine Sprache. Hinzu kommt der eigene Buchstabe „ł“, der dem deutschen Auge ein „L“ vortäuscht. Er wird ähnlich dem „w“ im englischen „well“ gehaucht. Das polnische Pedant zu „Paul“, „Paweł“, wird also wie „Pawewh“ gesprochen.
Französische Einflüsse
Als wäre das nicht genug Lautmalerei, ist mir beim Hören aufgefallen, dass zwischen der Weichheit die Stimme in die Nase geht. Das kommt mir doch bekannt vor… Klar! In Trier und Umgebung schnappt man öfters Französisch-Fetzen auf. Die Spurensuche endete bei den Buchstaben „ą“ und „ę“. Der erste klingt, wie das Ende von „Balkon“ und der zweite, wie das Ende von „Bassin“. Aber seht selbst:
Das Schmunzeln konnte ich mir nicht verkneifen. Zwischen all dem „sch-schtsch-cha“ taucht eine vollmundige Endung auf, bei dessen Sprechen man sich eher wie ein Französischschüler fühlt. Ach, Polen, immer für eine Überraschung gut. Woher das genau kommt, würde an dieser Stelle zu weit führen. Nur so viel: zum Einen hat sich auch der polnische Hofadel auf die Weltsprache des 18. Jahrhunderts verstanden. Und zum Anderen war Frankreich lange Zeit das Traumziel der Polen. Mehr dazu in einem späteren Blogpost.
Bis die Zunge tanzt
Vielleicht erscheinen meinen deutschen Bekannten deshalb slawische Wortfetzen als befremdlich. Sie klingen energisch, fließend, verschwommen. Man weiß als Außenstehender nicht genau, wann ein Wort aufhört und das nächste anfängt. Dazu kommen im Polnischen westeuropäische Einflüsse und Entlehnungen. Es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man seiner Zunge diese Artistik erfolgreich zumutet. Man taucht in einen Fluss aus Sprache ein, in dem man plötzlich einzelne Wellen und Wirbel ausmacht. Die anfängliche Überforderung weicht der Leichtigkeit.
Nochmal zurück zum Anfang. Jetzt versteht ihr schon ein wenig mehr, wie Polnisch funktioniert. Deshalb hier die Auflösung, wie man denn den Zungenbrecher aus dem Teaser ausspricht. War doch gar nicht so schwer, oder? Übersetzt bedeutet er so viel, wie „In Szczebrzeszyn tönt der Käfer im Schilfrohr.“ Und jetzt gönnt euren Zungen eine Pause; ihr habt es euch verdient.
